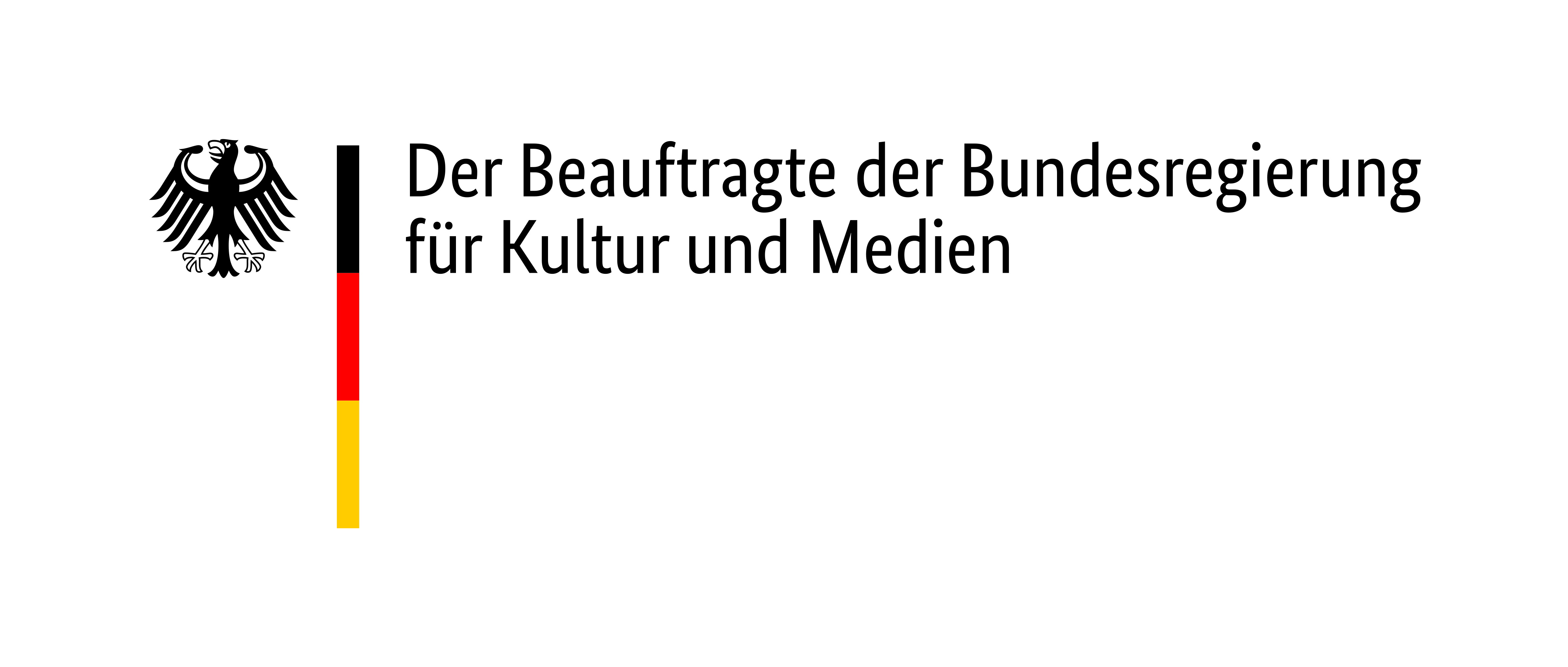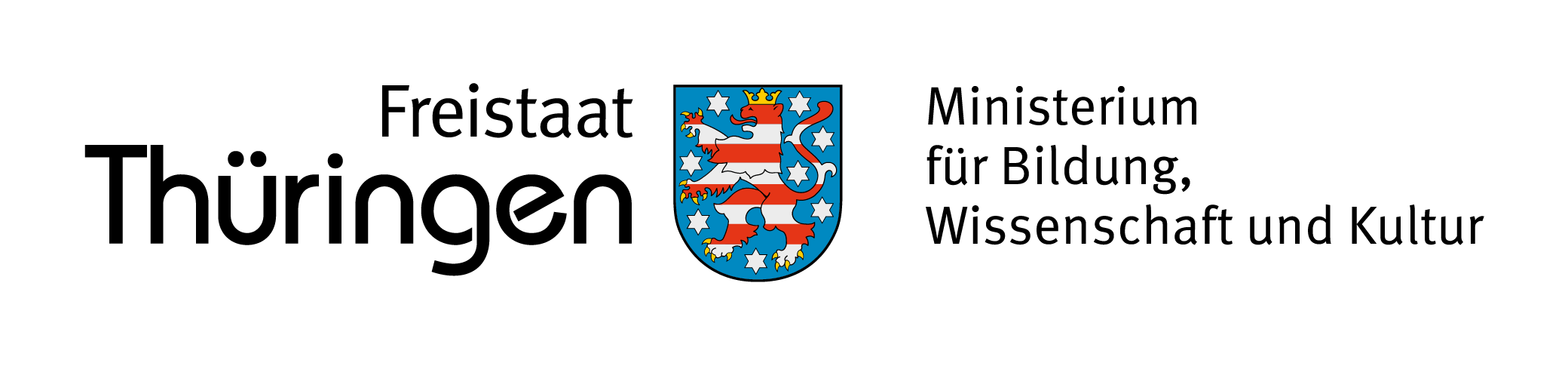1945 richtete die sowjetische Besatzungsmacht in Teilen des ehemaligen KZ Buchenwald das sowjetische Speziallager Nr. 2 ein. Bis 1950 waren dort 28.455 Personen interniert. 7.113 von ihnen starben aufgrund von Hunger und Krankheiten. Wer waren diese Menschen? Wie kam es zu diesem Lager? Warum wurde so lange darüber geschwiegen?
Student:innen der Friedrich-Schiller-Universität Jena beschäftigten sich mit diesen Fragen und geben Antworten in dieser neuen Ausstellung:
Deutsche Gewaltverbrechen und sowjetische Internierungen
„Nach einiger Zeit ein kurzes Lebenszeichen.“ Diese geheime Nachricht schickte Kurt Hortmann (1900-1948) aus Buchenwald. Als früherer Leiter des Arbeitsamtes Weimar war er an der Organisation der NS-Zwangsarbeit beteiligt gewesen. Wie andere NS-Belastete wurde er nach dem Krieg verhaftet. Aber auch Unschuldige und Denunzierte kamen in die sowjetischen Speziallager.
Leben und Sterben im sowjetischen Speziallager Nr. 2
Die meisten Internierten waren beschäftigungslos sich selbst überlassen. Es mangelte an Nahrung und Medikamenten; Krankheiten breiteten sich schnell aus. Kranke wurden mit primitiven Mitteln, wie mit dieser Schnabeltasse, versorgt. Während des „Hungerwinters“ 1946/47 kam es zu einem Massensterben.
Schweigen und Erinnerung
In der DDR wurden die sowjetischen Speziallager tabuisiert. Wenige Zeitungsberichte erschienen bei der Auflösung der Lager im Frühjahr 1950. In der Bundesrepublik dienten die Speziallager oftmals der Aufrechnung mit den NS-Verbrechen. Erst mit dem Ende der DDR begann die wissenschaftliche Erforschung der Speziallager. Nun konnte auch vor Ort an die Insassen des Speziallagers Nr. 2 in Buchenwald erinnert werden
Texte: Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena in Zusammenarbeit mit Franziska Mendler, Franz Waurig, Dr. Julia Landau, Prof. Dr. Jens-Christian Wagner
Design: ermisch I Büro für Gestaltung, Hannover